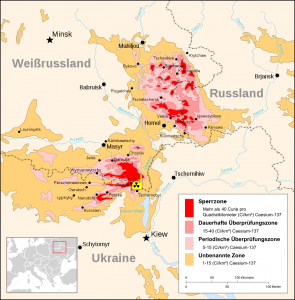Die Nacht war kühl am Ngorongoro-Krater. Das fand ich sogar, obwohl ich kurz zuvor noch -10°C in Stockholm gehabt hatte. Das war es aber nicht, was einen nachts zweimal überlegen ließ, das Zelt zu verlassen. Das war das Wissen, dass es da draußen wilde Tiere gibt und der Zeltplatz nachts unbeleuchtet und unbewacht war. Eine andere Gruppe kam gerade aus der Serengeti zurück und hatte die Nacht davor Giraffen am Zelt gehabt. Oben am Krater gab es nicht so viel, aber wenn tagsüber die Elefanten kommen, kann man nachts nicht ausschließen, dass sich auch mal etwas anderes ins Lager verirrt.
Gefährliche Tiere kamen dann im Serengeti-Nationalpark. Der dürfte jedem seit Bernhard Grzimek ein Begriff sein, auch wenn man natürlich keine konkrete Vorstellung davon hat. Der Name Serengeti kommt aus der Massai-Sprache und bedeutet „endloses Land“. Das ist auch ziemlich treffend, denn es ist im Wesentlichen eine riesengroße Ebene. Zunächst ist sie aber vor allem eines: staubig, denn die Steppe, durch die man bis zum Eingangstor fährt, ist schon sehr trocken.
Auf dem Weg in die Serengeti
Das Tor selbst steht auch mitten im Nirgendwo. Davor sitzen dann die letzten Massai, denn ab der Grenze zum Nationalpark ist jede Bewirtschaftung verboten. Wer sich dort dauerhaft aufhält, tut dies im Normalfall zum arbeiten. Bis man zur Station am Eingang kommt, sind es noch einige Kilometer. Dort ist ein kleines Besucherzentrum, ein kleiner Laden und ein Aussichtspunkt – alles schön gelegen auf einem bewachsenen Hügel mitten in der Steppe.
Dort machen aber nicht nur die Safariautos Pause. Die Serengeti liegt auch auf der Strecke von einigen Langstreckenbussen, die dann über die staubige Piste brettern. Derzeit ist auch eine Straße im Gespräch, die durch die Serengeti gebaut werden soll. Verständlicherweise ist das sehr umstritten, weil das die Tiere natürlich erheblich behindern würde.
Die ersten „neuen“ Tiere sahen wir dann auch noch in der Steppe: zwei Geparden. Das ist nicht so häufig, denn Geparden sind wie Leoparden meist Einzelgänger. Lediglich die Männchen bilden manchmal kleinere Gruppen.
Wie alles, was ich hier zu den Tieren erzähle, ist das nur mit Vorbehalt. Hat man einen so guten Guide bei einer Safari, wie wir ihn hatten, wird man jeden Tag mit einer Menge Informationen gefüttert, die man nachher nur noch in Teilen und dann auch nicht unbedingt korrekt erinnert. Ich habe mir zwar ein Buch mit den wichtigen Tierarten besorgt, aber beim Beschriften der obigen Fotos war ich oft sehr unsicher. V.a. bei den Vögeln mit den vielen Unterarten, die sich teilweise nur in kleinen Details unterscheiden, bin ich mir keineswegs sicher, was ich da vor der Linse hatte.
Neues Spielzeug
Apropos Linse: ich hatte mir vor der Reise ein Sigma-Objektiv 70-300 mm mit optischem Stabilisator besorgt. Im Nachhinein sind die Ergebnisse auf dem großen Bildschirm nicht so überragend, wie sie vielleicht auf der Kameraanzeige aussahen. Aber der optische Stabilisator war Gold wert, denn bei den Bedingungen ohne Stativ und teilweise während der Fahrt auf Schotterpisten Bilder zu machen wäre anders kaum möglich gewesen. Einziges Manko ist freilich, dass man damit natürlich keine kurzen Brennweiten hat und in so einer staubigen Umgebung das Objektiv wechseln muss. Ich behalf mir damit, das Objektiv nach Möglichkeit während der Tierbeobachtung die ganze Zeit drauf zu lassen, und irgendwelche Panoramafotos und dergleichen am Morgen oder am Abend zu machen. So musste ich nur zweimal am Tag einen Objektivwechsel machen. Das Ding ist jedenfalls sein Geld wert, und ich hätte es bitter bereut, wenn ich das billigste Objektiv genommen hätte.
Eine weitere „Überraschung“ war auch ein anderer Aspekt der Kamera. Ich hatte mir vor der Fahrt neben meiner vorhandenen 4-GB-Karte noch zwei langsame 16-GB-Karten von Sandisk geholt. Dass die Geschwindigkeit nicht hoch ist, merkt man höchst selten. Mir erschien das als blanker Wahnsinn, Karten mitzunehmen, die fast 3000 Fotos fassen. Immerhin hatte ich es zuvor kaum geschafft, auch nur die 4-GB-Karte einmal vollzukriegen. Die Erfahrung war aber, dass die Karte bei so einer Fahrt ohne Probleme vollzukriegen war. Wir kamen mit über 4000 Fotos alleine von meiner Kamera zurück. Das Risiko ist lediglich, dass eine solche große Karte im Falle eines Hardwareschadens oder Diebstahls natürlich auch einen großen Verlust darstellt.
Es gab schon eine Menge zu knipsen an diesem ersten Tag, darunter v.a. einige Nilpferde und Elefanten. Es waren freilich nicht die letzten, die wir sahen.
Elefanten sind so ziemlich die einzigen Tiere, die den Jeeps der Safaritouren gefährlich werden könnten. Ihre Gutmütigkeit wird dennoch strapaziert, denn die Autos veranstalten regelrechte Verfolgungsjagden, wenn eine Familie in Sicht kommt. Die Tiere stoßen dabei einen Ton aus, den man von Elefanten nicht kennt. Er übermittelt aber unmissverständlich, dass ihnen das nicht gefällt.
Es scheint aber so, dass Tiere und Safaritouristen sich arrangiert haben. Die letzte Etappe des Tages, das Serengeti-Besucherzentrum, war durch keinen Zaun geschützt. Das einzige Tier, das uns da begegnete, war ein Klippschliefer, der entgegen der Erwartung keinerlei Angst vor uns hatte.
Das Besucherzentrum und der anschließend angesteuerte Campingplatz „Dik-Dik“ haben übrigens eines gemeinsam: die sanitären Anlagen sind erste Sahne. Das Wasser kommt aus dem schwarzen Tank oben auf dem Dach, was für eine angenehme Temperatur sorgt, und das Gefälle in der Leitung sorgt für hinreichenden Fluss. Strom gab es freilich keinen (auf dem Campingplatz). Unser Koch war vermutlich deswegen auch so wenig gesprächig: er würde die folgenden zwei Tage dort herumsitzen, und die einzige Ablenkung war anscheinend sein Handy.
Für uns sorgte das natürlich schon für etwas Abenteuergefühl, dort draußen zu sein. Nach Einbruch der Dunkelheit wagten wir uns nicht mehr auf den Weg zum Toilettenhäuschen.
Die Nacht war aber auch nicht lang. Der Grund für das Ansteuern des Besucherzentrums war nämlich das Geschenk zu meinem 30. Geburtstag: eine Ballonfahrt über der Serengeti. Und so ein Flug beginnt sehr früh am Morgen.
Aber dazu später mehr.